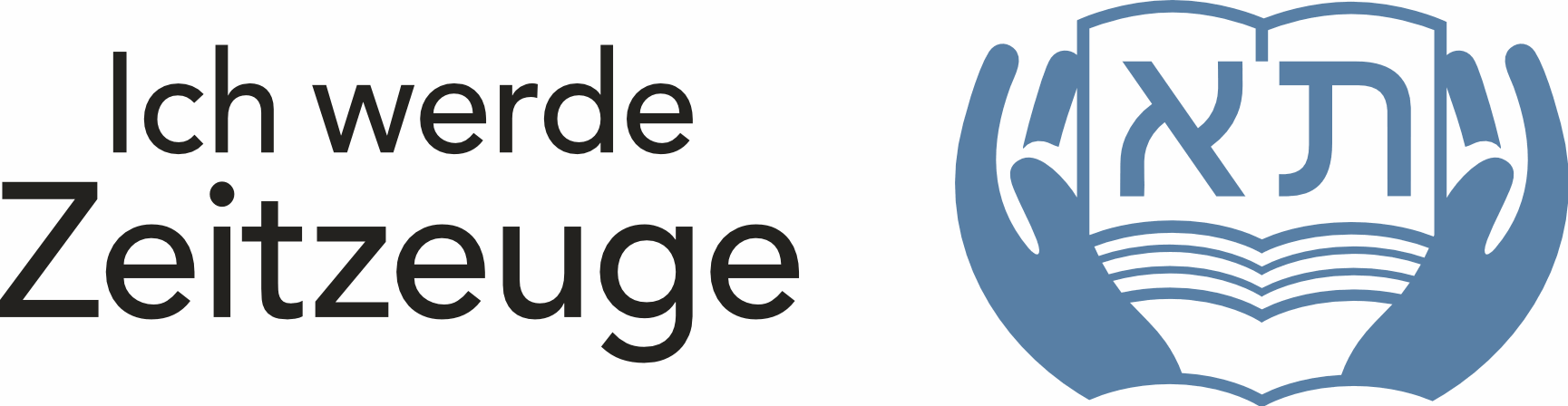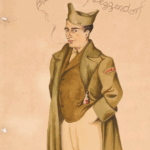- Geburtsdatum: –
- Geburtsort: Brooklyn
- Sterbedatum: –
- Sterbeort: -
- Staatsbürgerschaften: -
Biografie
Carl Atkin wurde 1903 als Sohn russischer Einwanderer in Brooklyn, New York, geboren.
Im Frühjahr 1945 bewarb sich Carl um eine Stelle bei der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), einer internationalen humanitären Organisation. Sie wurde im November 1943 gegründet und übernahm nach Kriegsende im Mai 1945 die Verwaltung der Sammelzentren und Lager für Vertriebene in den französischen, britischen und amerikanischen Zonen in Deutschland und half bei der Rückführung von Millionen von Menschen. Carl trat der UNRRA bei und meldete sich am 12. April 1945 in Washington, D.C., zum Training. Er ließ seine Familie zurück und kam am 1. Juni in England an, von wo aus er zu einem UN-Sammelpunkt in Heidelberg weiterreiste. Am 23. August führte er das UNRRA-Team 55 nach Deggendorf, einer ehemaligen Militärkaserne das in ein DP-Camp umgewandelt worden war. Als Carls Team Deggendorf übernahm, war es größtenteils mit ehemaligen Insassen des Ghetto-Arbeitslagers Theresienstadt bevölkert und schlecht verwaltet, mit Überbelegung, schlechten Lebensbedingungen und sanitären Einrichtungen sowie einem Mangel an Nahrungsmitteln und Kleidung.
Als Lagerleiter waren Carls oberste Prioritäten die Stabilisierung der Lebensmittelversorgung und die Sicherung von Unterkünften. Er ging das Problem der Überbelegung an, indem er die Zahl der im Lager zugelassenen Flüchtlinge reduzierte. Außerdem förderte er die demokratische Wahl eines Komitees und die Selbstverwaltung innerhalb des Lagers. Er verbesserte die physische Infrastruktur durch die Bereitstellung neuer technischer Ausrüstung wie Zentralheizung und Warmwasserbereiter, schuf ein neues großes Badehaus, reparierte die sanitären Anlagen und verbesserte allgemein die Wohnbedingungen. Unter seiner Leitung wurde im Lager eine Kantine eröffnet, in der Waren gekauft werden konnten, eine Währung für den Kauf dieser Produkte eingeführt und ein Bankensystem eingerichtet. Carl und sein Team förderten auch das kulturelle Leben mit Vorträgen, Konzerten, Aufführungen und der Gründung einer Gemeindezeitung, in der er eine wöchentliche Kolumne mit dem Titel „Gemeinschaftsgeist” schrieb. Für seine Führungsqualitäten, die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Stärkung der Moral in Deggendorf wurde er hoch gelobt und gab im Dezember 1945 seine Leitung auf, um eine Stelle als Koordinator für jüdische Angelegenheiten bei der UNRRA anzutreten. Vor seiner Abreise aus Deggendorf schenkte ihm die jüdische Gemeinde ein einzigartiges, selbstgestaltetes Erinnerungs- und Liederbuch das „Deggendorfer Liederbuch von 1945“. In seiner neuen Funktion reiste Carl zu zahlreichen DP-Lagern und beriet dort zu vielen der Verbesserungen, die er in Deggendorf vorangetrieben hatte, darunter die Einführung von Selbstverwaltung, Währungssystemen und Bildungseinrichtungen. Im März 1946 kehrte er in die USA zurück, wo er sich seiner Familie in Los Angeles anschloss und weiterhin für die UNRRA arbeitete.
1952 wechselte Carl in die Produktion und Dokumentation der Luft- und Raumfahrtindustrie. 1969 verstarb Carls Frau Frances. 1972 heiratete er Edith J. Katz und wurde Stiefvater ihres Sohnes Richard. Richard Katz vermachte 2007 den Nachlass von Carl Atkins zusammen mit dem „Deggendorf Liederbuch“ dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington, USA.