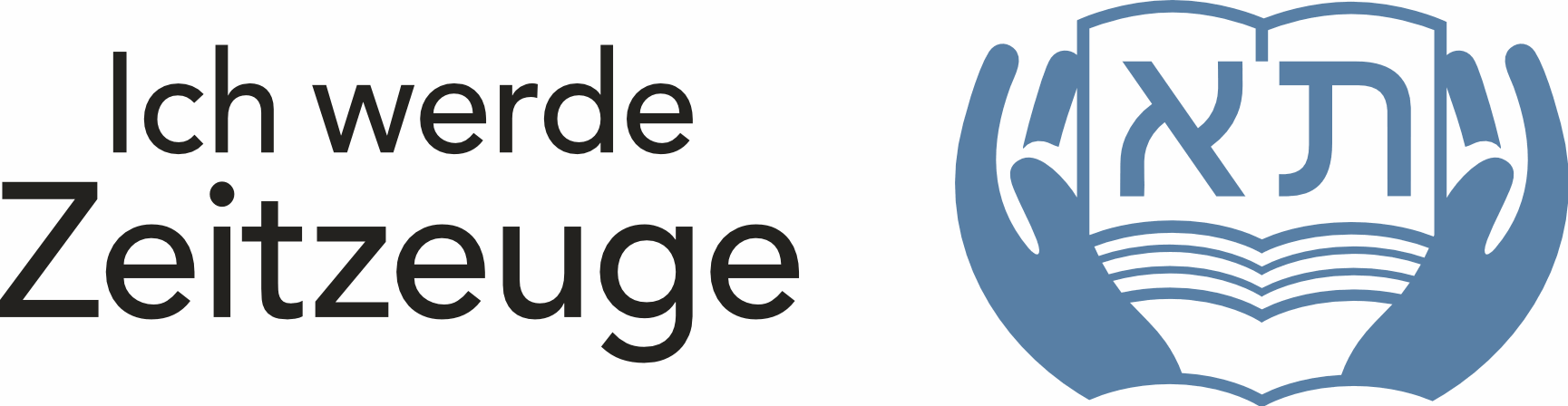Kapitel
- Die Rolle des Querido-Verlags für die jüdischen Autoren
- Lebensgeschichten von jüdischen Autoren und Verlagen
Datum
01.01.1915
Beschreibung
Der 1915 von dem niederländischen Juden Emanuel Querido geründete Verlag „Em. Querido’s Uitgeversmaatschappij N.V.“ entwickelte sich bis zu einem Verlag, der Heimstätte für viele weltberühmte jüdische Autorinnen und Autoren wurde:Heinrich und Klaus Mann, Anna Seghers, Arnold Zweig, Bruno Frank, Lion Feuchtwanger, Theodor W. Adorno, Albert Einstein, Oskar Maria Graf und mehr als 50 weitere renommierte jüdische Autorinnen und Autoren.
Der Verlag hatte seinen Sitz in Amsterdam, in der Keizersgracht 333.
Als Emanuel Querido 1915 in Amsterdam einen Verlag für Literatur gründet, ahnt er nicht, dass sein Haus knapp 20 Jahre später zur Heimat jüdischer Autor*innen wird, die vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen mussten. „Amsterdam: was für eine schöne, unverwechselbare Stadt! Sie wurde zur Zuflucht, sie lässt uns arbeiten“, so schwärmte Klaus Mann von einer seiner ersten Stationen im Exil. Und Amsterdam war nicht nur ein temporärer Wohnort, sondern versprach bald auch eine ganz andere Art von Heimat: Zwischen 1933 und 1950 veröffentlichte der Querido Verlag über 100 Bücher von Schriftsteller*innen, die vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen mussten, darunter Joseph Roth, Irmgard Keun und Lion Feuchtwanger.
Nach dem Exodus deutscher Schriftsteller im Frühjahr 1933 gründete der holländische Verleger Emanuel Querido innerhalb seines Verlages eine deutschsprachige Abteilung für die in Deutschland verfolgten und verbotenen Autoren. Teilhaber und Leiter dieser Abteilung wurde Fritz H. Landshoff, der als Direktor des Kiepenheuer Verlages in Berlin bis 1933 die Geschäfte eines der programmatisch fortschrittlichsten Verlagshäuser der Weimarer Republik geführt hatte. Durch die vorzüglichen Kontakte und das verlegerische Geschick Landshoffs entwickelte sich der Querido Verlag schnell zum wichtigsten Exilverlag der Jahre 1933 bis 1940.
Der zum Treuhänder bestimmte Untersturmführer „Renier van Houten“ beendet die Geschichte des wichtigsten Exilverlages jüdischer Künstler in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Europa.